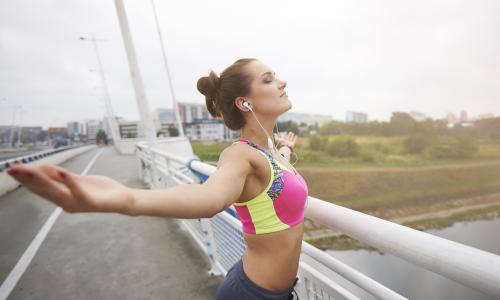Magdalena Lobnig ist seit Jahren Österreichs First Lady im Einer. Hier erklärt sie, wie sie ihr Gehirn austrickst, warum Musik beim Wassertraining ein No-Go ist und warum sie sich die Schmerzen im Boot überhaupt noch antut.
Magdalena Lobnig gehört zu den Sportlerinnen, deren Blick stets über den Tellerrand hinausgeht, oder um ein Bild aus ihrer Sportart zu verwenden: Ihre Welt endet nicht an der Bootsspitze. Zum Beispiel während der heißen Phase der Corona-Krise, als auch ihr das Training auf dem Wasser verboten war. „Natürlich hätte nichts dagegen gesprochen, wenn ich alleine im Einer meine Bahnen gezogen hätte, ich hätte ja niemanden anstecken können“, sagt sie. „Aber erstens war es nicht erlaubt und zweitens wollte ich auch keinen Unmut in der Bevölkerung provozieren, so nach dem Motto: Ich muss zu Hause bleiben und die kann sich auf der Drau austoben.“ Also verzichtete die 29-Jährige fünf Wochen auf das, was die Ruderer „Boots-Feeling“ nennen, das Wackeln, das Lesen des Wassers, des Windes und der Wellen. Und auf den Schmerz, der bei einer auf Geschwindigkeit gefahrenen Strecke über 2000 Meter so sicher kommt wie die Schwielen an den Händen.
Natürlich lag die Kärntnerin in der Zeit nicht auf der faulen Haut, ganz im Gegenteil. Fast täglich spulte sie Einheiten auf ihrem Indoor-Rudergerät ab, und um ihrem Kopf ein wenig Wettkampfmodus vorzugaukeln, startete sie mit ihrer Schwester Katharina, mit der sie früher im Zweier fuhr und bis heute auf Regatten unterwegs ist, ein spezielles Projekt. „Wir haben uns vorgenommen, mit dem Rad vier Sättel in unserer Umgebung in einer Tour zu fahren, was gut 2500 Höhenmetern entspricht. Ich war in den Tagen vorher richtig nervös, hab schlecht geschlafen und mich gefragt, ob ich das wirklich packe. So wie es bei einem wichtigen Rennen auch ist.“ Ein Sportlerleben ohne Wettkampf ist wie ein Boot ohne Ruder – der Antrieb fehlt.
Dabei kam Lobnig der wichtigste Wettkampf überhaupt vorläufig abhanden. Deshalb gibt sie unumwunden zu, dass sie – bei aller Richtigkeit der Entscheidung – erst einmal über Bord fiel, als die Olympischen Spiele auf 2021 verschoben wurden. „Als darüber debattiert wurde, dachte ich: Na ja, ist ja nicht so schlimm. Als es dann aber fix war, hab ich realisiert, dass die Spiele auf einmal richtig weit weg waren. Eine Woche lang hatte ich total Schwierigkeiten, mich zu motivieren.“ Und Motivation ist für eine Ruderin wie Lobnig das A und O, schließlich reißt sie in einem normalen Jahr mehr als 4000 Kilometer alleine auf dem Wasser ab. Damit kann man in elf Profijahren, die sie auf dem Buckel hat, viermal von Lissabon nach New York rudern – und wieder zurück.
Die Frage, ob sie sich die täglichen Einheiten auf der Drau mit etwas Musik versüßt, kostet sie ein müdes Lächeln. No way! Zum einen gilt es, sich bei jedem einzelnen Schlag zu konzentrieren, auf den Rhythmus zu achten und gegebenenfalls die Kommentare des Trainers im Begleitboot aufzunehmen. Und zum anderen würde sie es als akustische Umweltverschmutzung empfinden, wenn man die schöne Natur mit Bass und Beats behelligt. „Nur indoor auf dem Ergometer kann es gar nicht laut genug sein. Da brauche ich Techno, House oder Rock, um mich zu pushen.“
Mittlerweile weiß die Sportmanagement-Studentin auch wieder, wofür sie sich pusht. Der Ersatztermin für Olympia ist fixiert, im Oktober sollen die Europameisterschaften in Posen über den Maltasee gehen. Eine Strecke, mit der sie in inniger Freundschaft verbunden ist. Nicht nur wegen der Erfolge, die sie dort bereits einfuhr, sondern weil ihr 2017 auf diesem Fluss das Husarenstück gelang, mit 7:13,26 Minuten die bis heute gültige Weltcup-Bestzeit aufzustellen. „Dass mein Name schon so lange in dieser Bestenliste ganz oben steht, ist schon extrem cool“, sagt sie.

Ich dachte, ich habe mit Olympia noch eine Rechnung offen. Also habe ich meine Pläne über Bord geworfen und weitergemacht.
Überhaupt war 2017 für Magdalena Lobnig ein äußerst erfolgreiches Jahr, vielleicht sogar das wichtigste in ihrer Karriere. Denn eigentlich war sie sich sicher, nach den Olympischen Spielen in Rio ihre Karriere zu beenden. Dort belegte sie Platz sechs, holte also ein mehr als respektables Ergebnis, mit dem sie aber doch nicht richtig warm wurde. Eine schwer zu erfüllende Erwartungshaltung von Medien und Öffentlichkeit, ein bärenstarker Halbfinallauf, der die eigenen Ambitionen weckte und am Ende ein Rückstand von mehr als zehn Sekunden auf die Medaillenränge, der sie fuchste. Eine Melange, an der sie länger zu schlürfen hatte. „Das alles führte zu dem Gefühl, mein Maximum noch nicht gezeigt zu haben. Ich dachte, ich habe mit Olympia noch eine Rechnung offen. Also habe ich meine Pläne über Bord geworfen und weitergemacht.“
Und dann eine Saison zu Wasser gelassen, die es in sich hatte. Sieg im Gesamtweltcup, WM-Bronze in Florida und besagter Rekord. Und auch wenn 2019 aufgrund diverser Krankheiten und einem Trainerwechsel (mittlerweile wird sie vom Deutschen Robert Sens gecoacht, seit April auch österreichischer Bundestrainer) maximal durchwachsen war, weiß jeder in der Ruder-Szene: Wer ganz vorne mit dabei sein will, muss Magdalena Lobnig schlagen. Dementsprechend hat sie auch ihr Visier Richtung Tokio eingestellt. „Besser als Platz sechs sollte es schon sein, was nicht heißt, dass ich mit Rang fünf zufrieden wäre“, sagt sie. Dass sie dann mit Platz vier glücklich wäre, kann man getrost vergessen. Um aber wirklich beim Kampf um die Medaillen dabei zu sein, müssen am Tag X viele Faktoren zusammenkommen – nicht zuletzt auch das Glück.
„Rudern ist ein Mind Game“, sagt Lobnig. „Du fährst zwar gegen deine Konkurrentinnen, in erster Linie aber gegen die Zeit. Wenn dich wer überholt, siehst du die Gegnerin nicht mehr, sie ist schwer wieder einzufangen, du musst dich auf deine Taktik verlassen. Ab einem gewissen Punkt musst du alles hineinwerfen und kommst dabei auf einen Laktatwert von über 20.“ Das Schöne daran sei, sagt sie, dass jede Athletin komplett auf sich allein gestellt sei und niemanden außer sich selbst für Sieg oder Niederlage verantwortlich machen könne. Klingt nach einem Haifischbecken, in dem man nur überlebt, wenn man mit sich und seiner Art zu trainieren so im Reinen ist wie Magdalena Lobnig.